Inhalt des Beitrags
Die erzgebirgischen Dorfgeschichten von Karl May hab ich das letzte Mal als Teenager gelesen, meine ich. Das waren damals in der Bücherei die Bände „Aus dunklem Tann“ und „Der Waldschwarze“. Fromm und grausam. Und nun standen in unserem Bücherschrank in Dellbrück die Bände: „Erzbgebirgische Dorfgeschichten“ Band I und Band II aus dem Verlag Neues Leben. Natürlich habe ich sie mitgenommen und mich an die Lektüre gemacht.
Die Zusammensetzung ist ein bisschen anders als die des Karl-May-Verlags:
| Erzgebirgische Dorfgeschichten Bd I | Aus dunklem Tann |
| Sonnenscheinchen | Sonnenscheinchen |
| Des Kindes Ruf | Der Grenzmeister (anderer Titel für „Im Sonnenthau“) |
| Der Einsiedel | Der Teufelsbauer (anderer Titel für „Der Einsiedel“) |
| Der Dukatenhof | Der Bonapartenschuster (anderer Titel für „Der Kaiserbauer“) |
| Vergeltung („Der Waldschwarze“ im KM-Verlag) | Der Giftheiner |
| Der Geldmarder (anderer Titel für „Der Gichtmüller“) | |
| Die Rose von Ernstthal | |
| Anhang „Der Samiel“ als Faksimile (gab es in den alten Ausgaben meiner Bücherei nicht) | |
| Erzgebirgische Dorfgeschichten Bd II | Der Waldschwarze |
| Der Kaiserbauer | Der Dukatenhof |
| Der „Samiel“ | Der Herrgottsengel |
| Der Gichtmüller | Der Waldschwarze (anderer Titel für „Vergeltung“; Variation „Der Waldkönig“) |
| Der Giftheiner | Das Geldmännle |
| Im Sonnenthau | |
| Das Geldmännle |
Ja, die Verwirrung ist beträchtlich. An einige Geschichten konnte ich mich noch sehr gut erinnern, andere waren mir entfallen. Und z. B. „Die Rose von Ernstthal“ habe ich vermisst.

Im Karl-May-Wiki gibt es zu jedem Titel von Karl May Anmerkungen zur Veröffentlichungsgeschichte – und gerade die Sachen, die als Erzählungen in Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind, weisen da eine bunte Vielzahl als Variationen von Titel und Daten auf. Da hab ich die Infos für die Tabelle her.
Was erzählt Karl May in seinen erzgebirgischen Dorfgeschichten?
Er erzählt dramatische Geschichten von einfachen Leuten. Die Schwarz-Weiß-Malerei ist dabei sehr ausgeprägt. Und die Grausamkeiten – ich habe es oben ja bereits erwähnt – sind immens:
Sei es, dass jemand mit einem Pulverschuss geblendet wird, sei es, dass rollende Baumstämme Menschen die Beine zerschmettern oder Leute in Giftschwaden oder Wasserfluten umkommen – in fast jeder Geschichte gibt es Tote und Verletzte. Oder zu Unrecht Verurteilte.
Doch das Ende ist meist versöhnlich – allerdings sind die Bedingungen für die Bösewichte meist hart:
- Der Teichbauer Heinemann muss erst Todesängste bei einem gefährlichen Kampf auf einer Felskanzel durchleben, bis er sich und seinem Widersacher seine Schandtaten eingesteht. (Der Teufelsbauer/Der Einsiedel)
- Der Dukatengraf wird genauso verstümmelt wie der Köpfle-Franz (Der Dukatenbauer)
- Der Balzer verliert sein Augenlicht wie sein Opfer 20 Jahre zuvor (Der Giftheiner)
Die späten Geschichten
Die meisten der erzgebirgischen Dorfgeschichten erschienen in den 70er und 80er Jahren in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften – Karl May schrieb damals ums liebe Leben. Nach seinem Wandel vom Abenteuer-Autor zu einem mit pazifistischer Sendung, versuchte er, diesen Anspruch bereits für seine frühen Texte geltend zu machen. Deshalb schrieb er mit „Sonnenscheinchen“ und „Das Geldmännle“ zwei neue, symbolisch überhöhte Geschichten und gab sie 1903 zusammen mit einigen seiner Dorfgeschichten als Buch heraus. Im Vorwort weist er darauf hin, dass diese beiden Geschichten später entstanden sind, doch entfällt das Vorwort bei den späteren Ausgaben – für meine Erstlektüre hatte ich diese Information also nicht und hab „Das Geldmännle“ in die gleiche Kategorie gesteckt wie „Der Dukatenhof“ oder „Der Giftheiner“. (Zu diesem Absatz gibt das Karl-May-Wiki Informationen her, die ich hier genutzt habe.)
Gerade die Geschichte vom Geldmännle hab ich in meiner ersten Rezeption der erzgebirgischen Dorfgeschichten gemocht. Hier kommt der Humor nicht zu kurz – die Ziege Karlinchen tanzt ganz allerliebst. Die Vorgeschichte zum „Bergle“ ist bezaubernd. Und für alle Blutrünstigen gibt es auch genug Tote und Grusel.
Den Prolog hab ich aus Spaß an der Freud mal eingelesen:
Erzgebirgische Dorfgeschichten und Münchmeyer-Romane
Eine besondere Verbindung besteht hier zwischen den Geschichten und den beiden Kolportage-Romanen, die in Deutschland spielen:
Die ganzen Schmuggel-Geschichten kommen in Variationen in „Der verlorene Sohn“ in der Abteilung „Sclaven der Arbeit“ vor. Insgesamt gibt es auch in den kurzen Geschichten erstaunlich oft verborgene Räume und verdeckte Türen auf Rollen usw. – ein für mich typisches Merkmal der Münchmeyer-Romane.
Die Titel „Der Samiel“ kommt sowohl in „Der Weg zum Glück“ als auch in den Erzählungen vor, die hier Thema sind. Im Großen und Ganzen ähnelt sich die Geschichte. Da jedoch in „Der Weg zum Glück“ der Wurzelsepp als komisch wirkende und mächtig agierende Hauptfigur ein bisschen was zu tun bekommen muss, ist die Geschichte viel breiter angelegt. Der Hauptaspekt – eine sexuell sehr aktive und egoistische* Frau agiert als Wilddieb und Einbrecher – bleibt gleich.
*Geht natürlich gar nicht – die „lüsterne“ Frau muss böse sein. Das sehen wir auch in „Des Kindes Ruf“. Der Name Samiel ist dabei natürlich Programm: Carl Maria von Weber nutzt den Namen für den Teufel in „Der Freischütz“. Laut Meyers Großem Konversationslexikon von 1909 handelt es sich – in der Schreibeise Sammaël – um den Engel, der Adam und Eva versuchte und in der jüdischen Tradition als oberster Teufel angesehen werde.
Meinem Kitschempfinden passen die erzgebirgischen Dorfgeschichten auch heutzutage mal ganz gut 🙂 – und der Einfallsreichtum an Bosheiten und Strafen und Erlösungen, da ist Karl May einfach gut …
- Karl May: Erzgebirgische Dorfgeschichten, Bd. I , Verlag Neues Leben, Berlin, 2000, ISBN: 3355015172
- Karl May: Erzgebirgische Dorfgeschichten, Bd. II , Verlag Neues Leben, Berlin, 2001, ISBN: 3355015202
Falls Sie Lust auf die Münchmeyer-Romane bekommen haben – ich habe die Blogbeiträge als E-Book zusammengefasst und das können Sie hier erwerben.

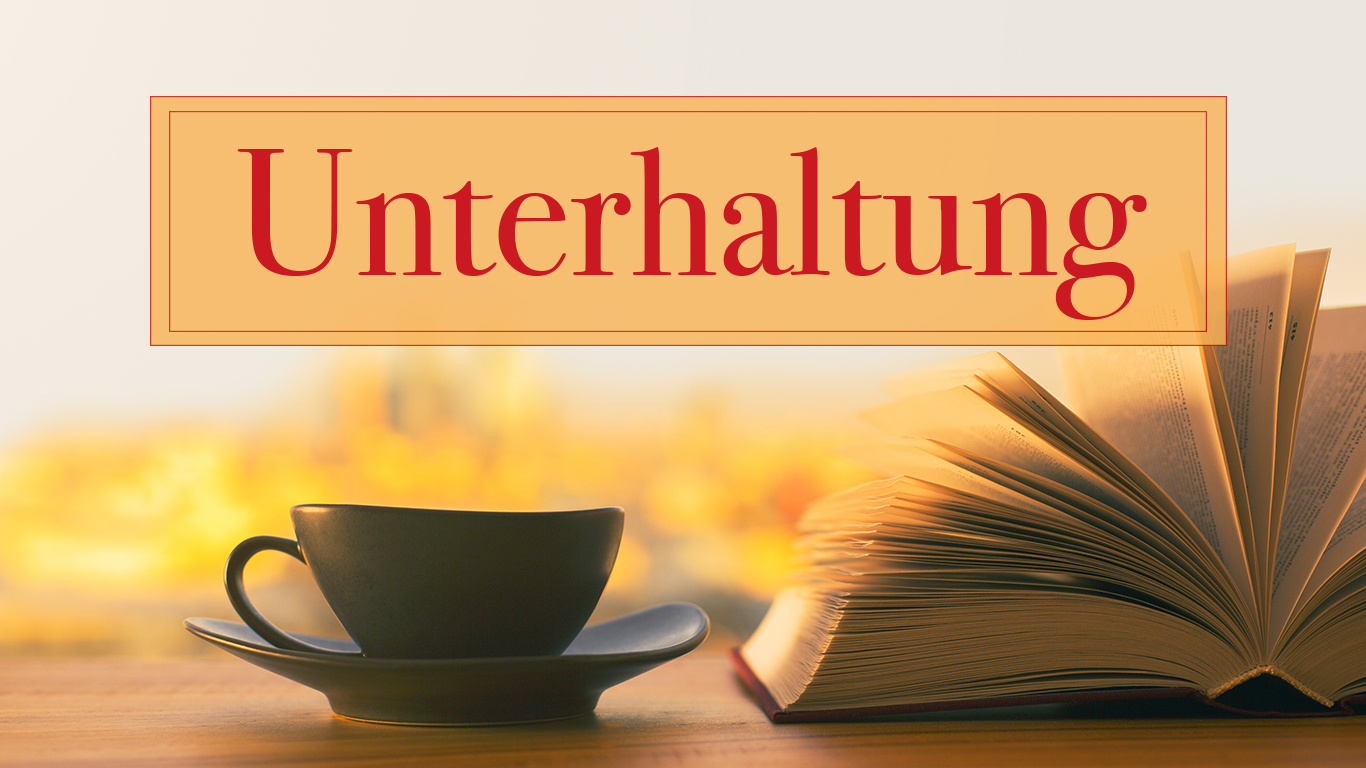
Bisher gibt es noch keine Kommentare